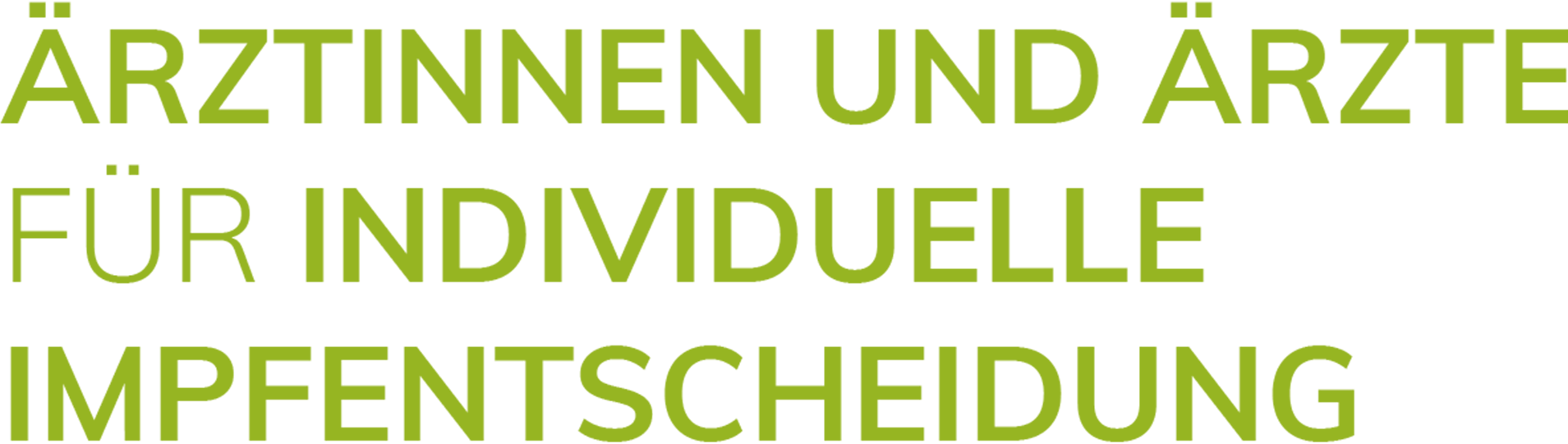syn. gelbsüchtig
Kostenlos: der ÄFI-Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden beim Thema
Impfungen & Impfentscheidung und rund um den Verein.
Glossar
Hier finden Sie die wichtigsten Fachbegriffe aus unseren Fachbeiträgen zu Impfungen anschaulich erklärt und mit Beispielen untermauert. Die Beschreibungen werden auch in den jeweiligen Fachbeiträgen wie folgt angezeigt:
Die grüne Markierung und diese Sprechblase 💬 zeigen an, dass für diesen Fachbegriff eine Beschreibung verfügbar ist. Die Kurzbeschreibung erscheint in Form eines grünen Textfeldes beim Scrollen des Fachbegriffs (den Mauszeiger über den Begriff bewegen). Mit Klicken auf den Fachbegriff wird die Glossar-Seite geladen und die vollständige Beschreibung erscheint. Hier können dann auch andere Fachbegriffe durch Aufklappen des grünen Kastens mit dem Plus-Symbol nachgeschlagen werden. Die Sortierung ist automatisch alphabetisch und lässt sich nach Buchstaben filtern.
Glossar
Hier finden Sie die wichtigsten Fachbegriffe aus unseren Fachbeiträgen zu Impfungen anschaulich erklärt und mit Beispielen untermauert. Die Beschreibungen werden auch in den jeweiligen Fachbeiträgen wie folgt angezeigt:
Die grüne Markierung und diese Sprechblase 💬 zeigen an, dass für diesen Fachbegriff eine Beschreibung verfügbar ist. Die Kurzbeschreibung erscheint in der mobilen Ansicht in Form eines grünen Textfeldes durch Klicken auf den jeweiligen Fachbegriff. Beim zweiten Klicken auf den Fachbegriff wird die Glossar-Seite geladen und die vollständige Beschreibung erscheint. Hier können dann auch andere Fachbegriffe durch Aufklappen des grünen Kastens mit dem Plus-Symbol nachgeschlagen werden. Die Sortierung ist automatisch alphabetisch und lässt sich nach Buchstaben filtern.
ikterisch
die Gelbsucht betreffend bzw. mit Gelbsucht einhergehend
Imflammasom
Proteinkomplex, der nach entzündlichen Signalen gebildet wird.
Die Sekretion erfolgt durch spezifische Interleukine. Inflammasome sind Teil der angeborenen Immunantwort.
Immunflucht
Prozess in der Infektiologie, bei dem Pathogene durch Mutation der Erkennung oder Abwehr vom Immunsystem (adaptive Immunreaktion) entgehen.
Eine solche Variante (z. B. SARS-CoV-2-Omikron) wird auch Immunfluchtmutante genannt, die Entstehung entsprechend Fluchtmutation. Zu den Mechanismen, die die Mutation ermöglichen, zählen auch Virulenzfaktoren.
Immunglobulin
syn. Antikörper, lebenswichtige Eiweiße, die im Blut zirkulieren und als Bestandteil des Immunsystems wichtige Schutzfunktionen vor Fremdkörpern bzw. Krankheitserregern übernehmen
Der primäre Antikörpertyp im menschlichen Blut ist das Immunglobulin G (IgG). Als Arzneimittel können Immunglobuline zur passiven Immunisierung und Immuntherapie eingesetzt werden.
Immunität
Schutz bzw. Unempfindlichkeit gegenüber Krankheitserregern
Nach Genesung durch eine Infektionskrankheit entstehen spezifische Antikörper wie B-Lymphozyten und Immunzellen wie T-Lymphzyten, die bei erneuter Infektion bzw. Kontakt mit dem Antigen eine bessere Reaktionsfähigkeit (Immunantwort) des Organismus gewährleisten.
Immunogenität
Fähigkeit eines Antigens, eine adaptive Immunantwort im Körper auszulösen.
Z. B. gewünschte Immunreaktion mit Entwicklung von Immunität, aber auch die Fähigkeit eine Reaktion wie einen anaphylaktischen Schock oder eine Autoimmunreaktion hervorzurufen. Der Grad der Immunogenität ist auch vom Immunsystem des Organismus abhängig. Bei der Immunogenität eines Stoffes wird ferner erforscht, welche Immunzellen aktiviert werden (B-Zellen mit Antikörperbildung, T-Zellen etc.).
Immunreaktion
Reaktion des Immunsystems beim Eindringen von körperfremden bzw. potentiell schädlichen Stoffen (Krankheitserreger, Pathogene).
Dabei wird zwischen der angeborenen und adaptiven Immunantwort unterschieden. Die angeborene Immunantwort nutzt vererbte Mechanismen und reagiert schnell, aber auf alle Krankheitserreger gleich, weshalb es auch als „unspezifisches“ Immunsystem bezeichnet wird. Das adaptive Immunsystem hingegen entwickelt durch Kontakt mit der Umwelt über die Differenzierung von T- und B-Zellen ein immunologisches Gedächtnis und kann somit auch im Wiederholungsfall spezifisch reagieren.
Immunseneszenz
Fortschreitende Funktionsabnahme des Immunsystems, die durch das Alter bei jedem Menschen hervorgerufen wird.
Die Immunseneszenz bewirkt eine verminderte Immunfunktion, durch die Menschen immer anfälliger für Infektionen und schwere Verläufe von Infektionskrankheiten werden, je älter sie sind.
Immunsuppression
Unterdrückung oder Beeinträchtigung des Immunsystems
syn. Immunschwäche; Wird entweder durch eine Erkrankung ausgelöst oder im Rahmen einer Therapie mit Medikamenten bewirkt.
Immuntoleranz
Ausbleibende bzw. stark beeinträchtigte Reaktion des Immunsystems gegenüber einem spezifischen Antigen
Eine medikamentös herbeigeführte Immuntoleranz wird Immunsuppression genannt.
Impfdurchbruch
Erkrankung trotz Schutzimpfung
Eine durch einen RT-PCR-Test bestätigte symptomatische Infektion (etwa Fieber oder Halsschmerzen) bei einem durch die Impfung immunisierten Menschen. Der Impferfolg kann aus verschiedenen Gründen ausbleiben, s. auch Impfversagen.
Impfkomplikation
Impfreaktionen, die länger als drei Tage andauern oder solche, die mit drei oder mehr Tagen Abstand zur Impfung auftreten.
Bei Impfkomplikationen wird dann auch von einer unerwünschten Arzneimittelwirkung (UAW) gesprochen. Die Bundesregierung rät dazu, in solchen Fällen auf jeden Fall ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Je nach Impfstoff können diese Komplikationen nach Impfung sehr unterschiedlich ausfallen. Die zuständige Meldestelle ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bzw. das Paul Ehrlich Institut.
Impfnebenwirkung
Beschreibt das Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAWs) nach Impfung.
Unterschieden werden muss hier zwischen Impfreaktionen und Impfkomplikationen, zu denen auch anerkannte Impfschäden & das SARS-CoV-2 spezifische Post-Vac-Syndrom zählen.
Impfprogramm
Nationale oder internationale Pläne über empfehlenswerte Impfungen, abhängig vom Alter, der epidemiologischen Situation und anderen Faktoren.
Auf nationaler Ebene stellt die Ständige Impfkommission (STIKO) Impfempfehlungen aus, auf internationaler Ebene u. a. die Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Impfreaktion
Unbedenkliche, meist lokale Anzeichen einer Immunantwort des Körpers auf die Impfung
In der Regel treten Impfreaktionen innerhalb eines Tages oder einiger Tage auf. Dazu zählen Rötungen, Schwellungen, Schmerzen an der Einstichstelle und allgemeine Reaktionen wie Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost oder Fieber.
Impfregister
Ein bevölkerungsbezogenes System zur Dokumentation, Überwachung und Bewertung von Impfstatus und -wirkung
In Deutschland gibt es kein Impfregister, hier werden durch das Robert Koch-Institut Daten über Angaben von Arztpraxen, Krankenhäusern, Impfteams, Betriebsärztinnen und -ärzten und neuerdings Impfzentren gewonnen. In anderen Ländern wie Dänemark und Finnland kommt demgegenüber ein nationales Impfregister schon seit Jahren zum Einsatz. So werden auch Daten über unerwünschte Wirkungen besser erfasst, wohingegen das deutsche Paul-Ehrlich-Institut auf verschiedene Gruppen (Ärzte, Apotheker, Hersteller etc.) angewiesen ist, die Verdachtsfälle melden (Passives Spontanmeldesystem).
Impfschaden
Gesetzliche Anerkennung einer Impfnebenwirkung, die den Betroffenen gesundheitlich oder wirtschaftlich beeinträchtigt.
Wenn eine Impfnebenwirkung eine längerfristige gesundheitliche oder wirtschaftliche Folge für den Betroffenen bedeutet, dann muss nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) ein Antrag auf Impfschaden beim zuständigen Versorgungsamt gestellt werden, um als Impfgeschädigter anerkannt zu werden. Gegen eine Ablehnung des Antrages kann über Sozialgerichte juristisch vorgegangen werden.
Impfserie
Notwendigkeit zur Verabreichung mehrerer Dosen mit einem bestimmten Impfstoff...
..., um die Immunität langfristig zu verbessern – meistens bei Totimpfstoffen.
Induration
Pathologische Verhärtung von Gewebe, verursacht z. B. durch eine Erkrankung oder Therapie
Infektionsschutzgesetz
Bundesgesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
syn. IfSG; unter Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie sonstigen Beteiligten. Im Zuge der Corona-Pandemie kam es 2020 zur Etablierung eines eigenen Paragraphen (§ 28a), um bundesweite Schutzmaßnahmen wie Kontaktreduzierungen anordnen zu können. Der Paragraph 28a lief am 7. April 2023 ab.
Infektionssterblichkeit
Anteil Verstorbener an allen Infizierten
Anders als bei der Fallsterblichkeit werden auch asymptomatische Fälle einbezogen; engl. infection-fatality-rate.
Infektiösität
Eigenschaft eines Erregers, nach der Übertragung einen Wirt zu infizieren.
Dies ist abhängig von verschiedenen Faktoren, etwa der Pathogenität des Keimes.
Inkubationszeit
Ansteckungszeit
Zeitraum zwischen Infektion und dem Auftreten der ersten Symptome. Dies fällt bei Erkrankungen sehr unterschiedlich aus.
Interessenskonflikt
In der Forschung liegt ein Interessenskonflikt vor, wenn finanzielle, persönliche oder andere Gründe Einfluss auf das Urteilsvermögen haben könnten.
Ein Beispiel für einen Interessenskonflikt ist die Durchführung einer Studie durch einen Forscher, der ein Honorar von einem Unternehmen für diese Arbeit erhält oder daran ein finanzielles Interesse hat. Das Vorhandensein von Interessenkonflikten gilt nicht als unenthisch, diese jedoch nicht zu deklarieren schon.
Interferon-α-Therapie
eine Familie von Proteinen aus der Gruppe der Zytokine, die als Antwort des Immunsystems auf virale Infektionen gebildet wird.
syn. IFN-α; Die Proteine sind an der an der Regulation der Immunreaktion und der Blutbildung beteiligt. Aufgrund dieser Eigenschaften lässt sich Interferon-α zur Behandlung von Hepatitis B und C aber auch Multiple Sklerose einsetzen.
intestinal
den Darm betreffend bzw. zu ihm gehörend
intramuskulär
innerhalb eines Muskels gelegen bzw. in einen Muskel hinein erfolgend
Bspw. Verabreichung einer Impfung mittels intramuskulärer Injektion in einen Skelettmuskel.
intrauterin
innerhalb der Gebärmutter liegend bzw. erfolgend
intravenös
innerhalb einer Vene gelegen bzw. in eine Vene hinein erfolgend
intrazellulär
Das Innere der Zelle betreffende
Ferner auch Prozesse und Stoffe innerhalb der Zelle.
invasiv
Der Begriff bedeutet „eindringend“ und wird in der Medizin in verschiedenen Kontexten verwendet.
So werden maligne Tumore, die benachbartes Gewebe zerstören, Mikroorganismen, die in Gewebe eindringen und diagnostische bzw. therapeutische Verfahren, die mit einem Eingriff in den Körper verbunden sind, so bezeichnet.
Inzidenz
Häufigkeit
Ein Begriff der Statistik, der die Häufigkeit von Neuerkrankungen bzw. Infektionen in einer definierten Personengruppe und eines bestimmten Zeitraumes angibt. Beispielsweise wird bei der 7-Tages-Inzidenz die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner angegeben.