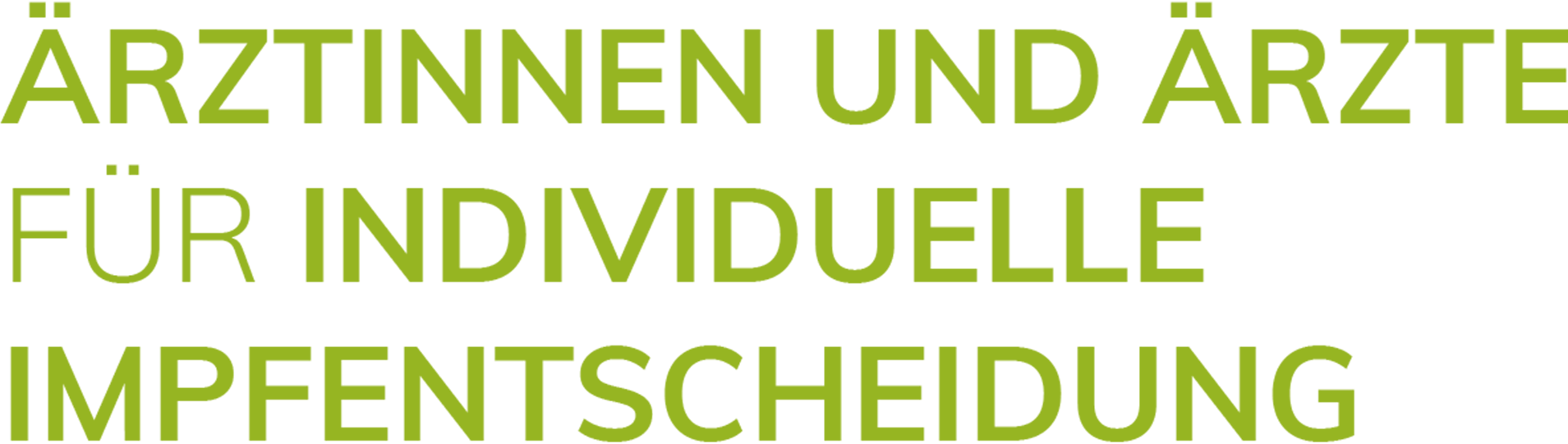- Covid-19-Impfung
Novavax vor der Zulassung – ein Beitrag zur Einordnung
Die Proteinimpfstoff-Technologie ist grundsätzlich schon länger in Verwendung. Sie wird z. B. bei Hepatitis B- oder HPV-Impfstoffen eingesetzt und damit bei Impfstoffen, deren Verträglichkeit schon immer auffallend problematisch war. Bei beiden wurde und wird z. B. ein Zusammenhang zu schweren neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose diskutiert (Näheres unter impf-info.de).
Ein weiteres Hauptproblem dieser Technologie liegt in der aufwändigen Herstellung der Impf-Proteine und dadurch in der deutlich langsameren Anpassbarkeit an neue Virus-Varianten wie z. B. Omikron.
Dass Adjuvantien/Wirkverstärker eine durchaus verhängnisvolle Rolle bei Impfstoffen spielen können, zeigte das Pandemrix®-Desaster. Die bei diesem Impfstoff auftretende bleibende Nebenwirkung der Narkolepsie, die vor allem bei geimpften Kindern auftrat, wird dem verwendeten Adjuvans ASO3 zugerechnet.
Als Proteinimpfstoff muss Novavax nur bei normaler Kühlschranktemperatur gelagert werden.
Studienlage
Die Zulassungsstudien mit Novavax liefen vom 27. Dezember 2020 bis zum 18. Februar 2021 – also zu einer Zeit, in der in den USA und Mexiko (den Studienorten) die Alpha-Variante dominierte (Dunkle 2021).
Die relative (!) Risikoreduktion betrug 90 Prozent für symptomatische und 100 Prozent für schwere Verläufe. Bei letzteren allerdings mit sehr großen Konfidenzintervallen aufgrund der kleinen Zahl mittelschwer (10) oder gar schwer (4) Erkrankter in der Studie. Eine differenzierte Betrachtung dieser rein medizinhistorisch interessanten Ergebnisse ist nicht relevant, findet sich aber bei Lisa Dunkle zum Nachlesen und im Deutschen Ärzteblatt auf deutsch zusammengefasst.
Grundsätzliche Schwächen dieser Studie sind neben dem sehr geringen Anteil älterer Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer auch die frühzeitig aufgehobene Verblindung der Studie – viele wollten sich offenbar mit einem sicheren Verum geimpft wissen und bestanden auf der Information, ob sie zur Placebogruppe gehörten (Dunkle 2021). Und natürlich wurde diese Studie vom Hersteller finanziert.
Die Verträglichkeit des Impfstoffs wurde gegen Kochsalzlösung als Placebo geprüft. Speziell nach der zweiten Dosis zeigten sich bei bis zu 40 Prozent der Verum-Gruppe relevante Nebenwirkungen, die bei bis zu 8 Prozent als schwer eingestuft wurden. Das ist zwar weniger als bei den außergewöhnlich schlecht verträglichen mRNA- und Virus-Vektor-Impfstoffen, aber dennoch auffallend.
Fazit
Es liegen Ende 2021 zu Novavax systematisch ausgewertete Erfahrungen von knapp 20.000 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer vor, was einen verschwindend geringen Bruchteil der Erfahrungen mit anderen Impfstoffen darstellt wie z.B. BioNTech oder AstraZeneca. Dass wir bei letzteren das erhebliche Nebenwirkungsrisiko einzelner Subgruppen Geimpfter, wie z.b. das der Myokarditis bei jungen Männern oder das der Sinusvenen-Thrombose bei jüngeren Frauen haben identifizieren können, ist nur durch die immense Zahl der bisher verimpften Dosen möglich gewesen. Von diesem Wissensstand sind wir bei Novavax noch weit entfernt.
Andere Impfstoffe mit der von Novavax verwendeten Technologie zeigen eine vergleichsweise schlechte Verträglichkeit und möglicherweise auch das Risiko schwerer neurologischer Komplikationen.
Über das Sicherheitsprofil des erstmalig verwendeten Wirkverstärkers sind keinerlei evidenzbasierte Aussagen möglich.
Aktuell zeigt sich die stark eingeschränkte bis fehlende Wirksamkeit anderer Impfstoffe, die direkt oder indirekt mit der Antigenstruktur des originalen SARS-CoV-2 arbeiten (BioNTech, AstraZeneca u.a.). Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass Novavax von diesem Problem der Immunevasion ausgenommen sein wird. Eine Anpassung an aktuelle Virusvarianten ist bei dieser Technologie nicht in epidemiologisch relevanten Zeiträumen zu erwarten.
Quellen:
Karl Lauterbach, 24. November 2021
Dunkle et al., 2021
Deutsches Ärzteblatt, 17. Dezember 2021